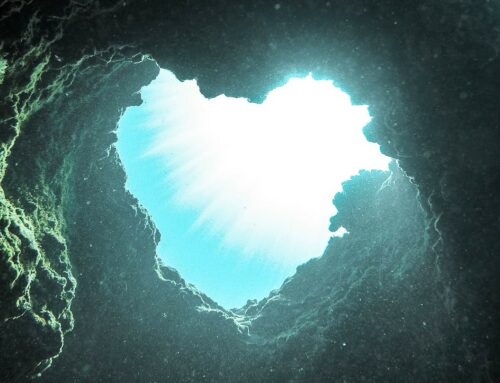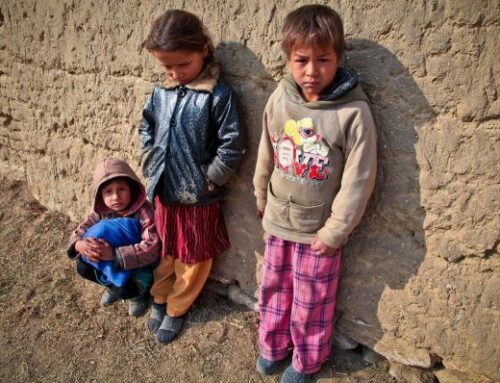[Zum Abschluss soll die Gilbdrossel nochmals zu Ehren kommen, der Nationalvogel Costa Ricas.]
14. Februar 2024
Den Wind von gestern Abend hätte man bei uns als „Sturm“ bezeichnet. Als ich gegen halb neun Uhr abends zum Auto ging, um mein vergessenes Buch zu holen, bogen sich die größten Bäume wie Gräser unter seiner Gewalt. Oben ein kristallklarer, sternenübersäter Himmel und um mich dieser Gigant von Wind, der mit den Urwaldriesen spielte, die es hier noch gibt. Wer schon einmal erlebt hat, wie sich eine Brandung gegen ein Felsriff wirft, der kann sich die Vorstellung von einer Luftbrandung machen, die der Wind gegen den Wald und die Welt wirft. Ein bisschen spürt man hier noch die Schöpfung walten; man ist jedenfalls viel näher dran als in Europa, wo auch eine Windmaschine statt des Windes denkbar ist, weil wir doch alles besser wissen.
Mini-Episode: In der Lounge der Casa Batsú, auf spiegelsauberen, braun marmorierten Steinfliesen, taucht ein kleiner, dunkelgrüner Frosch auf, vielleicht vier bis fünf Zentimeter groß. Da es hier Frösche gibt, die nicht so harmlos sind wie die deutschen Frösche, gehe ich nach nebenan und verständige Carlos, unseren Gastgeber. Er kommt mit einem Stück Küchenkrepp, nimmt das Kerlchen vorsichtig hoch und trägt es nach draußen. „Thank you“, sagt er, „it’s too dry in here. You’ve saved a life.“ Kurz zuvor hatte ich ein kleines Gespräch mit ihm. „In my young days“, sagte er so nebenhin, „capital served us to build a better life. Nowadays we’ve become servants of the capital, we are its slaves.“
Heute ist Valentinstag + Aschermittwoch, die witzige Kombination legt Friedhofspartys nahe. Na ja, letzter Tag in Costa Rica. Das Frühstück in der Casa Batsú ist fantastisch, pochierte Eier nach türkischer Art mit Joghurt, Olivenöl, einem Hauch Knoblauch und Dillspitzen wird ab Viertel vor sieben serviert. Um acht Uhr sind wir mit unserem Guide Christian am Curi Cancha Reservat verabredet. Leider macht uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung, aber anders als man in Deutschland denkt: Statt mystischer Nebelwaldstimmung ist es hier auf der Pazifikseite sonnig mit blauem Himmel. Der viele Wind hat die Vögel weitgehend in Deckung gescheucht, so dass es „nur“ schön ist. Mich beeindrucken die riesenhaften Würgefeigen; in eine kann man hineingehen, weil der umklammerte Baum längst abgestorben ist.

Die Würgefeige von innen
„Zum Trost“ für die wenigen Tiere weiß Christian fünf Stellen für Lanzenottern im nahen Refugio Monteverde. Wir fahren dorthin und finden tatsächlich eins der scheuen, giftigen Tiere. Wir stehen am Wegrand direkt davor und sehen nichts. Erst als Christian uns mit seinem Laserpointer auf die Stelle aufmerksam macht, entdecken wir sie auch: Als gelber, wie ein Gartenschlauch zusammengerollter Ball hängt die Schlange schlafend in einem Busch keine drei Meter vor uns.

Die Lanzenotter beim Mittagsschlaf
Nach diesem letzten „Erfolg“ holten wir unsere gepackten Koffer in der Casa Batsú ab und machen uns auf die Rückfahrt nach Santa Ana. Auf halbem Weg (der ca. vier Stunden dauert) machen wir ne Pause im Restaurante La Cuenza an einem Fluss. Das Restaurant ist beschattet von zwei großen Mangobäumen, die schwer von (noch unreifen) Früchten sind.
Das Navisystem Waze führt uns auf eine wildromantische Strecke, die aber gefühlt zur Hälfte aus Schotterstraße und Schlaglöchern besteht und häufig nur im 1. Gang zu bewältigen ist. Viel Stress für Gepa und Ila, die endlich (!) ankommen will. Stattdessen dürfte unsere Durchschnittsgeschwindigkeit bei 20 km/h liegen. Ich befürchte ziemlich oft einen Achsenbruch, wenn wir mal wieder ein tiefes Schlagloch übersehen haben. Das wäre dann nämlich der ultimative GAU. Bin ich mal grade nicht am Fürchten und kann aus dem Fenster schauen, kann ich wenigstens die atemberaubende Berglandschaft bestaunen, während Ila einfach nur sauer über die Strecke ist. Kurz vor San José, ab Ciudad Colon ist die Straße wieder geteert, und die Region verwandelt sich von gefühlt Dritter Welt in ein Villenviertel, kurz danach fahren wir in die erste Geschäftsstraße ein. Absolut verblüffend.
Die Posada Nena erreichen wir, nachdem wir noch vorschriftsgemäß vollgetankt haben, gegen 17 Uhr. Das für uns gedachte Zimmer bekommen Uru und ich nicht, weil es – am Abend – noch nicht gemacht ist. Aber okay, wir erhalten besseren Ersatz im ersten Stock und erfahren nebenbei, das andere Zimmer sei deswegen noch nicht gemacht und alle Fenster und Türen stünden offen, weil es mit Insektiziden behandelt wurde. Aha …
Der nächste Spaß: Wir können das Auto, so heißt es, nicht hierlassen und morgen früh mit einem Transferbus zum Flughafen fahren. So war es aber abgemacht, aber leider nur mündlich. Der Autoverleiher mit dem schönen Namen „Amigo“ entpuppt sich als „enemigo“. Knallhart heißt es: „Entweder Sie bringen das Auto noch heute Abend vorbei oder morgen um 13.30 Uhr, wie im Vertrag notiert.“ Andernfalls saftige Vertragsstrafe. Hm … zu wenig Spanisch, zu unaufmerksam, zu vertrauensselig bei der Auto-Übergabe. Ich bin schuld. Ich hatte mir schon ein Bierchen bereitgestellt, um einen gemütlichen, letzten Abend einzuläuten, aber jetzt müssen Gepa und ich das Auto die ca. 25 Kilometer zur Agentur in Flughafennähe zurückfahren und von dort ein Taxi zurück zur Posada nehmen.
Als wir losfahren wollen, funktioniert die Startelektronik nicht. Ich telefoniere mit Amigo, dort kann man sich das gar nicht erklären, ich soll ein Video von der blinkenden Kontrolllampe machen und per WhatsApp schicken. Mach ich, hilft nichts, man will einen Mechaniker befragen. „Please wait at the phone.“ Das alles angesichts der Information, dass „Amigo“ um 21 Uhr dicht macht. Plötzlich und unvermutet funktioniert die Startautomatik. Prompt landen wir in dichtem Berufsverkehr. Der Weg dauert statt 25 Minuten knapp eine Stunde, u.a. auch deswegen, weil wir an einer Tankstelle zum Pinkeln halten und Gepa routinemäßig den Motor abstellt. Und wieder muckt die Startautomatik, lässt sich dann aber nach aufregenden weiteren ca. fünf Minuten „überreden“. Wenigstens funktioniert die Autorückgabe reibungslos. Mit der Taschenlampe wird der Toyota auf Schäden abgeleuchtet, die es zum Glück nicht gibt.
Aber wie kommen wir ohne Auto zurück zur Posada? Tja, meint der einfallslose Amigo-Mann, das wisse er auch nicht, sie würden nur die Transfers zum Flughafen organisieren. Wie’s denn mit einem Taxi wäre, frage ich. Oh, meint er, das sei tatsächlich eine Idee. Er ruft an: Kein Taxi verfügbar. Wir könnten ja auch einen Uber nehmen, meint er, ob wir die Uber-App hätten. Haben wir nicht. Installation auf die Schnelle klappt auch nicht. Gegenüber am Platz ist ein Hilton-Hotel. Wir könnten von dort ein Taxi rufen lassen. Wir gehen in die Lobby, aber die Rezeption ist grade überlastet, weil eine große Reisegruppe am Einchecken ist. WLan gibt’s nur für Gäste. Also zurück zu „Amigo“, wo es gelingt, ein Taxi zu ordern, das tatsächlich auch nach fünf Minuten kommt. Visakarte könne er nicht nehmen, sagt der Fahrer, „only cash“. Wir haben aber kein Cash mehr. Nach mühsamem Spanisch und seinem Anruf bei der Zentrale, der ich nochmals alles erkläre, heißt die Lösung „Cajeto automatico“ (das spanische Wort für „Geldautomat“ hatte ich mir zum Glück notiert). Also rauscht er mit uns los, fährt in Rekordgeschwindigkeit nach Santa Ana, steuert einen Bankautomaten an, wo ich die Taxigebühr abhebe und ihm in die Hand drücke. Zehn Minuten später sind wir „zu Hause“. Endlich doch noch das Feierabendbier.

15. Februar
Um 4:30 Uhr klingelt der Wecker, wir duschen noch schnell, denn um fünf Uhr werden wir vom Transferbus abgeholt. Zwar liegen die versprochenen Sandwiches als Frühstücksersatz nicht bereit, aber der Transfer zum Flughafen klappt problemlos. Am Flughafen sagt der Fahrer flugs „Adios!“ und will kein Geld von uns. Auch gut. Um sechs Uhr sind wir am Schalter zum Einchecken bei Air Canada. Es stellt sich heraus, dass wir auch hier ein Durchreise-Zertifikat brauchen (ähnlich bürokratischer Sicherheitswahnsinn wie in den USA). Mit der aufopfernden Hilfe einer rundlichen, superhilfreichen Costa-Ricanerin, der Teamleiterin der Air-Canada-Schalter, schaffen wir dann nach ca. einer stressigen Stunde alle vier den Check-in.

Der Blick zurück
19:44 h Toronto-Time. Auch hier mussten wir als Transit-Passagiere durch eine Handgepäckkontrolle inklusive flüchtigem Bodycheck, aber keine Schuhe ausziehen und keine Kontrolle via Gesichtserkennung und Fingerabdrücken wie in den USA. Ich sitze an einem Tisch eines Flughafen-Selbstbedienungsrestaurants, um mich Aberhunderte von Menschen. Ich habe mit Uru den wunderbaren Roman des (in seinem Land sehr bekannten) costa-ricanischen Autors Fernando Contreras Castro „Der Mönch, das Kind und die Stadt“ begonnen – jedem zu empfehlen, der gerne verblüffende Inhalte, gepaart mit ausgesuchten Formulierungen, liest. Auffällig viele Menschen indischer Herkunft sind hier versammelt und viele davon sind schöne Menschen. Vor vielleicht einer halben Stunde kam ein junger Mann vorbei, der mir so überwältigend schön erschien, dass ich Uru unbedingt anstoßen musste, damit ihr dieser optische Hochgenuss nicht entgeht. Wenigstens ein Vorteil dessen, dass Kanada zum Commonwealth gehört, dessen Mitgliedsländer keiner Visapflicht unterliegen (Indien, Kanada, Großbritannien, Australien, Neuseeland).
Kleiner (witziger?) Eindruck aus der Herrentoilette: Alle Kabinen waren besetzt und zwei junge Männer warteten darauf, an die Reihe zu kommen, beide tief in ihr Handy vertieft, was offenbar den Druck auf die Körperschleusen senkt. Unser Flug geht um 21:20 Uhr ab Gate 76 (auf Spanisch heißt das interessanterweise „puerta“, die Tür).
 Schon bei der Landung haben wir erfahren, dass Toronto eben einen Schneesturm hinter sich hat, so dass wir eine halbe Stunde kreisen mussten, bis die Landebahn vom Schnee geräumt war und wir sicher landen konnten.
Schon bei der Landung haben wir erfahren, dass Toronto eben einen Schneesturm hinter sich hat, so dass wir eine halbe Stunde kreisen mussten, bis die Landebahn vom Schnee geräumt war und wir sicher landen konnten.
Auch unser Abflug zieht sich hin „wie Gummi“ in die Nacht, denn der nächste Flieger muss nochmals durchgecheckt werden. Wir sitzen schon eine Weile in der Maschine, die in Richtung Startbahn bummelt, aber dann bleiben wir wieder stehen. Während wir auf den Startschub der Düsen hoffen, kommen zwei seltsame Kranfahrzeuge aus der Dunkelheit mit Scheinwerfern an die beiden Flügel herangefahren, leuchten das Metall der Flügel und Start- und Landeklappen ab und besprühen sie dann mit Enteisungsflüssigkeit (vermuten wir jedenfalls). Obwohl wir mit 1,5 Stunden Verspätung abheben, hat sich unsere Ungeduld in Grenzen gehalten, denn ganz klar gilt hier „safty first“.
Wir sind rund siebeneinhalb Stunden in der Luft (inkl. Abendessen und einem Frühstückssnack). Man liest, döst vor sich hin, unternimmt gelegentlich Maßnahmen gegen einschlafende Pobacken. Der Fahrgastraum ist den längsten Teil der Zeit abgedunkelt, wer lesen will, kann sich ein kleines Leselicht einschalten. Zwischendurch vertreibe ich mir die Zeit mit einer WIRKLICH guten Satire, dem Film „Willkommen Mr. Chance“ von Hal Ashby (mit Peter Sellers und Shirley MacLaine, sehr empfehlenswert: ein „Trottel“ wird umständehalber zum amerikanischen Präsidenten). Im Landeanflug schaue ich auf den tristen Frankfurter Großraum, krame nach „Freude auf Deutschland“ in mir, werde aber nicht fündig. Gegen halb ein Uhr nachmittags landen wir. Schreck in der Nachmittagsstunde: Mein Handy ist weg. Kann nicht sein, darf nicht sein! Uru findet es zum Glück – schwarz auf dunklem Boden – unter dem Sitz. Uffff …
Unsere Koffer kommen erstaunlich schnell (und vollzählig) auf dem Gepäckband. Also ist noch Zeit für Kaffeepause, bevor uns der ICE nach Würzburg fährt. Home, bitter-sweet home.

Flughafen Frankfurt