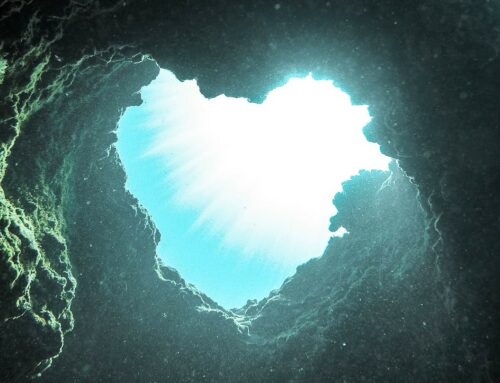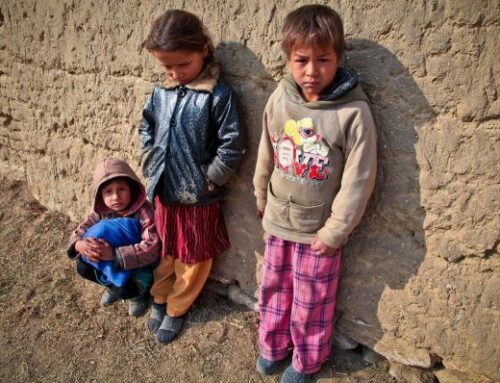27. Oktober
An diesem Abend übernachte ich bei Lucia und Alistair, einem verwunschenen Haus am Ende eines Feldwegs, nur mit dem Jeep befahrbar. Kein Mensch käme auf die Idee, dass da noch etwas Bewohnbares liegt. Ein Riesengrundstück, das Haus mit zwei Terrassen übereinander, die kleinere dreiecksförmig unter der großen darüber. Ein Großteil des Lebens spielt sich hier ab.
Lucia hat das Haus gemietet, könnte es potenziell auch kaufen, aber es gibt noch eine Reihe von Unwägbarkeiten. Der Vermieter ist ein Schwuler, der dieses Haus für die Liebe seines Lebens gebaut hat. Als vor zwei Jahren alles in die Brüche ging, ist er geflüchtet und hat das Haus mit sämtlichem Inventar (Möbel, Kunstwerke …) zurückgelassen, will es nicht mehr sehen. Homosexueller Herzschmerz made in Guatemala. Man könnte das vermutlich zu nem interessanten Film verarbeiten.
Die nächsten fünf Tage bin ich in nem AirB&B in Antigua. Das hat den Vorteil, dass jeder von uns tun und lassen kann, was sie oder er mag, ich kann schreiben und die Stadt erbummeln. Wie auch immer, das passt mir gut so. Ist ein sanfter Übergang ins Alleinsein. An diesem Morgen trinken wir erstmal was zusammen, plaudern und spielen mit den zwei kleinen Kätzchen (ein Antihistaminikum hab ich schon gestern Abend eingenommen und heute Morgen nochmals). Später fahren wir nach Antigua und darüber hinaus auf eine Finca, wo wir im Freien ’ne Kleinigkeit essen. Zwei Stunden setze ich mich an meinen Laptop und vervollständige mein Guatemala-Tagebuch, Lucia und Alistair sind mit Webkonferenzen beschäftigt. Lucia hat danach (ca. eineinhalb Stunden) die spontane Idee, noch ein Stück weiter in Richtung Küste zu fahren, wo eine Finca genau zwischen drei Vulkanen liegt. Sie hofft darauf, dass der eine vielleicht sogar ein bisschen spuckt, aber abgesehen vom guten Kuchen im Freien und dem trotzdem imposanten Anblick wurde ihre Hoffnung enttäuscht.
 Langsam wird’s Zeit, in mein AirB&B einzuchecken. Mal sehen, in Antigua sind jetzt am Wochenende die Parkplätze rar. Aber wer sagt’s, genau vor „meinem“ Haus ist einer frei! Bei meiner Wohnung handelt es sich um eine Mini-Wohnküche gleich hinterm Eingang und dahinter einer kleinen Nasszelle mit Toilette. Nach rechts oben klettert eine Treppe steil in den ersten Stock und mündet direkt in mein Schlaf- und Arbeitszimmer – mit Schreibtisch. Klein, aber nicht eng. Irgendwie erinnert das Apartment an die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, denn abgesehen von den weißen Wänden ist sonst alles braun: der Fußboden, die Treppenstufen, das Geländer, der Boden (mit ungefähr 25 Zentimeter breiten Dielenbrettern, wahrscheinlich aus Tropenholz) und der Schreibtisch. Trinkwasser gibt’s aus einem Wasserballon aus bläulich transparentem Kunststoff, der kopfüber in einen ca. fünf Liter fassenden Behälter des gleichen Materials gesteckt wird. Daraus kann man dann sein Trinkwasser über einen kleinen Zapfhahn entnehmen. Das System scheint hier weit verbreitet zu sein: „Agua Pura de Salvavidas“, Excelencia en Purificación. Das klingt doch sehr beruhigend für einen verpimpelten Westler wie mich.
Langsam wird’s Zeit, in mein AirB&B einzuchecken. Mal sehen, in Antigua sind jetzt am Wochenende die Parkplätze rar. Aber wer sagt’s, genau vor „meinem“ Haus ist einer frei! Bei meiner Wohnung handelt es sich um eine Mini-Wohnküche gleich hinterm Eingang und dahinter einer kleinen Nasszelle mit Toilette. Nach rechts oben klettert eine Treppe steil in den ersten Stock und mündet direkt in mein Schlaf- und Arbeitszimmer – mit Schreibtisch. Klein, aber nicht eng. Irgendwie erinnert das Apartment an die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, denn abgesehen von den weißen Wänden ist sonst alles braun: der Fußboden, die Treppenstufen, das Geländer, der Boden (mit ungefähr 25 Zentimeter breiten Dielenbrettern, wahrscheinlich aus Tropenholz) und der Schreibtisch. Trinkwasser gibt’s aus einem Wasserballon aus bläulich transparentem Kunststoff, der kopfüber in einen ca. fünf Liter fassenden Behälter des gleichen Materials gesteckt wird. Daraus kann man dann sein Trinkwasser über einen kleinen Zapfhahn entnehmen. Das System scheint hier weit verbreitet zu sein: „Agua Pura de Salvavidas“, Excelencia en Purificación. Das klingt doch sehr beruhigend für einen verpimpelten Westler wie mich.
Mein Apartamento liegt in der Innenstadt, so dass wir den Wagen hier einfach stehen lassen können. Lucia und Alistair haben sich mit Lucias Mutter zum Essen in einem altbewährten Restaurant verabredet, wo ich schon mal „was Einheimisches“ schmausen soll. Kann ich jetzt durchaus vertragen. Von Jetlag ist nichts zu spüren. Zu Fuß sind es keine zehn Minuten dorthin.
Das Essen war prima, der Wein auch und die Gespräche verliefen ohne jede Sprachbarriere. Lucias Mutter hat ja als guatemaltekische Konsulin einige Jahrein Kanada gelegt (wo Lucia auch die Grundschule besuchte), spricht also fließend Englisch.
Zurück im Apartamento freue ich mich übers W-Lan, das genauso flutscht wie zu Hause. Ich bin zwar groggy, aber wenn ich jetzt nicht die nächsten Einträge in den Guatemala-Blog hochlade und meinen Verteiler benachrichtige, bin ich hoffnungslos hinten dran. Am Anfang staut sich’s einfach. Also setze ich mich nochmals an den Rechner und erledigen die Sachen langsam im Halbschlaf.
28. Oktober
Ich schlafe gut ein, wache aber wegen eines Knalls auf, der sich wie ein Kanonenschuss anhört. Wieder und wieder ertönt der bedrohliche Krach, auch diverse kleinere Schüsse. Gedanken wie „Beginnt der neue Bürgerkrieg?“ schießen mir durch den Kopf, mein Herz klopft. Soll ich vor die Tür gehen und schauen? Bis ich mir klarmache: „Du kennst keine Kanonenschüsse, Bobby. Das ist reine Interpretation.“ Also mache ich mich wieder – erfolgreich – ans Weiterschlafen. Morgens finde ich diese Erklärung: Die „Kanonenschüsse“ sind offenbar Fehlzündungen von Lastwägen, die kleineren Schüsse die von Autos. War aber auch falsch: Junge Leute vergnügen sich mit einer althergebrachten Maya-Tradition, möglichst laut Krach zu machen, damit die Segenswünsche für die Toten (in Kürze ist ja der Dia de los Muertos) von den Göttern und Geistern auch garantiert gehört werden. Wie man das früher machte, kann mir Alistair nicht sagen, heute jedenfalls, indem man eine größere Menge Schießpulver zündet (wer sich’s leisten kann) und eine kleine Menge (das waren die kleineren Schüsse), wenn das Geld für mehr nicht langt.
Morgens unter der Dusche lerne ich wieder etwas dazu. Drehe ich sie stark auf, ist das Wasser lauwarm, drehe ich sie nur leicht auf, ist es heiß. Die Erwärmung findet nämlich im ziemlich großen Duschkopf statt, der nicht nur eine Wasser-, sondern auch eine Stromzuführung hat. Jedenfalls sorgt diese Konstruktion dafür, dass ich mich nicht „mal schnell abdusche“, sondern janz jemütlich. Tut gut und hilft mir bei der Entschleunigung. Shampoo finde ich in meinem Toilettenbeutel nicht (sondern erst später), also nutze ich eine von den zwei kleinen Seifen am Waschbecken.
Ganz eindeutig muss ich meine Gewohnheiten sowie Fühl-, Denk- und Erwartungsmuster neu justieren. Mein gewohntes heißes Wasser am Morgen muss ich durch kaltes ersetzen, denn es gibt keinen Wasserkocher, sondern nur zwei alte Kochplatten, aber keinen Topf dafür. Auf den ersten Blick erscheint alles normal, ist es aber nicht. Irgendwie fühle ich mich innerlich ein wenig zittrig, so als wäre meine Lebensgrundlage (noch) nicht in der erwünscht geruhsamen Balance. Auch die Finger landen bei der Datenbank-Arbeit für den Neuen Weg (noch) nicht selbstverständlich auf den Tasten. Neben dem Laptop krabbelt auf dem Schreibtisch eine kleine Ameise herum. Sie stört mich und ich fühle mich gedrängt, sie zu töten, bin aber gehemmt, es zu tun. Ich könnte mit einem Buch auf sie schlagen. Könnte … jetzt fällt mir auf, dass dieses Arbeitszimmer kein Tageslicht hat, jedenfalls so gut wie keines, sondern anstelle eines Fensters nur acht quadratische Glasbausteine, von denen nur die obersten zwei Tageslichtzugang haben. Auf elektrisches Licht angewiesen zu sein, will mir gar nicht gefallen, nur ändern kann ich’s nicht, genauso wenig wie die stickige Luft, weil sich auch das Fenster in Miniküche nicht öffnen lässt. Entspann dich, Bobby, ist ja nur für ein paar Tage!
 Wie ich da so sitze, in einer interessanten, fremden Stadt, bin ich ein lebender Berg an Bedeutungslosigkeit, weil mir nichts in meiner Umgebung Bedeutung zuweist (mit Ausnahme von Alistair und Lucia). Ich bin ganz auf mich gestellt. Nur ich bin mir etwas oder nichts, hängt alles von mir ab.
Wie ich da so sitze, in einer interessanten, fremden Stadt, bin ich ein lebender Berg an Bedeutungslosigkeit, weil mir nichts in meiner Umgebung Bedeutung zuweist (mit Ausnahme von Alistair und Lucia). Ich bin ganz auf mich gestellt. Nur ich bin mir etwas oder nichts, hängt alles von mir ab.
Nach getaner Arbeit mache ich mich auf zum Plaza Central. Dort, meinte Alistair, seien einige Cafés, wo man gut frühstücken könne. Aber wie da hinfinden? Der Plaza soll ganz in der Nähe sein, aber auch die Nähe hat vier Himmelsrichtungen. Okay, ich hätte auf Google Maps schauen können, aber darauf kam ich nicht. Stattdessen spreche ich auf der Straße einen jungen Mann an, der leider kein Englisch spricht. Trotz meines radebrechenden Spanisch‘ begreife ich, dass er da auch hinwill, dass er dort in einer Sprachenschule arbeitet und dass er gerne Englisch lernen würde.
 Die ganze Stadt ist übrigens Welterbe-Stätte. Alle Häuser sind letztlich Bungalows, ein- oder zweistöckige Häuser gibt es nicht, es sei denn als große Verwaltungsgebäude, Kirchen und Ruinen. Letztlich sieht man den Häusern ihr Alter kaum an, obwohl sehr viele Hunderte von Jahren alt und manchmal sehr groß sind, indem sie sich bis zur nächsten Parallelstraße ausdehnen. Sämtliche Straßen verlaufen parallel bzw. im rechten Winkel zueinander und sind gepflastert. Dabei darf man nicht an unsere pseudoromantischen Pflaster denken, sondern hier ist das Pflaster wie vor dreihundert Jahren. Man hat einfach große Steine von halbwegs gleicher Höhe solange in den Boden gerammt, bis es eine Straße ergab – ein Straßenbelag, der die nächsten tausend Jahre halten dürfte. Fliegt ein Stein unter Belastung mal raus, wird er entweder wieder zurückgeklopft oder durch nen neuen ersetzt. Wer hier schnell fährt, ruiniert sein Auto. Ich würde mal sagen: 40 km/h wäre hier „schnell“.
Die ganze Stadt ist übrigens Welterbe-Stätte. Alle Häuser sind letztlich Bungalows, ein- oder zweistöckige Häuser gibt es nicht, es sei denn als große Verwaltungsgebäude, Kirchen und Ruinen. Letztlich sieht man den Häusern ihr Alter kaum an, obwohl sehr viele Hunderte von Jahren alt und manchmal sehr groß sind, indem sie sich bis zur nächsten Parallelstraße ausdehnen. Sämtliche Straßen verlaufen parallel bzw. im rechten Winkel zueinander und sind gepflastert. Dabei darf man nicht an unsere pseudoromantischen Pflaster denken, sondern hier ist das Pflaster wie vor dreihundert Jahren. Man hat einfach große Steine von halbwegs gleicher Höhe solange in den Boden gerammt, bis es eine Straße ergab – ein Straßenbelag, der die nächsten tausend Jahre halten dürfte. Fliegt ein Stein unter Belastung mal raus, wird er entweder wieder zurückgeklopft oder durch nen neuen ersetzt. Wer hier schnell fährt, ruiniert sein Auto. Ich würde mal sagen: 40 km/h wäre hier „schnell“.
 Das Frühstück nehme ich im Café Condesa ein. Da gäbe es zwar auch das grauenhafte Continental Breakfast, aber ich entscheide mich für ein Guacamole-Frühstück (Avocados gibt’s hier nämlich in Massen) und lasse mich überraschen. Ich bekomme vier halbe, dick mit Guacamole bestrichene und mit Keimlingen überstreute Scheiben dunkles, getoastetes Brot, eine halbe gewürzte, getoastete Tomate und ein Glas mit gestückelten, Früchten: Wasser- und Honigmelone sowie Ananas, alles ganz frisch und mit einem Aroma, dass ich meinen könnte, ich hätte noch nie Melone gegessen. Auch der Kaffee schmeckt gut, dazu gibt es keine Kondensmilch, sondern heiße Milch im Kännchen. Als ich meine Tasse geleert habe, kommt die rundliche Mestizin gleich und fragt mich, ob sie mir nachschenken darf. Das scheint hier üblich zu sein: Zahl für eine Tasse, bekomme zwei. Die Tasse kostet üblicherweise (an touristischen Orten wie diesem) 15 Quetzal, also ungefähr 1,90 €.
Das Frühstück nehme ich im Café Condesa ein. Da gäbe es zwar auch das grauenhafte Continental Breakfast, aber ich entscheide mich für ein Guacamole-Frühstück (Avocados gibt’s hier nämlich in Massen) und lasse mich überraschen. Ich bekomme vier halbe, dick mit Guacamole bestrichene und mit Keimlingen überstreute Scheiben dunkles, getoastetes Brot, eine halbe gewürzte, getoastete Tomate und ein Glas mit gestückelten, Früchten: Wasser- und Honigmelone sowie Ananas, alles ganz frisch und mit einem Aroma, dass ich meinen könnte, ich hätte noch nie Melone gegessen. Auch der Kaffee schmeckt gut, dazu gibt es keine Kondensmilch, sondern heiße Milch im Kännchen. Als ich meine Tasse geleert habe, kommt die rundliche Mestizin gleich und fragt mich, ob sie mir nachschenken darf. Das scheint hier üblich zu sein: Zahl für eine Tasse, bekomme zwei. Die Tasse kostet üblicherweise (an touristischen Orten wie diesem) 15 Quetzal, also ungefähr 1,90 €.
Zum Glück habe ich mir die „Zimtläden“ von Bruno Schulz eingesteckt (Anregung für mein Schreibprojekt), denn Alistair braucht ne gute Stunde, bevor er auftaucht. Da ist auch viel Zeit, um die anderen Besucher ins Auge zu fassen. Beispielsweise setzt sich zwei Tischchen weiter ein junges, sehr europäisches Pärchen an den Tisch, beide ausgesprochen gutaussehend, er langhaarig hippiesk, sie in einem dicht blaugrüngelb gemusterten langen, rückenfreien Kleid mit einer auffälligen, hübschen Tätowierung entlang der Wirbelsäule. Nach einer Weile, als sie schon am Zahlen sind – er hat nur einen Kaffee getrunken, sie gar nichts – kommen zwei Frauen, die zum Lokal gehören, und fragen, ob sie ihren Rücken fotografieren dürfen. Sie ist gleichermaßen entzückt wie verwirrt von dieser Frage, willigt gerne ein, beugt sich nach vorne über den Tisch, rafft ihr Haar aus dem Nacken, so dass sich die Tätowierung in ihrer ganzen Schönheit entfaltet. Nachdem die beiden Frauen wieder gegangen sind, schaut sie ihren Freund verblüfft fragend und grinsend an, dann zahlen sie und gehen.
Nicht ganz so amüsant sind meine zwei linken Nachbarinnen, vermutlich Amerikanerinnen, eine Mutter und eine Tochter, die Mutter an die 50, die Tochter um die 25. Die Mutter ist eher hager und irgendwie vogelscheuchig, die Tochter dafür umso fetter. Das betont sie mit ihrem Minirock. Als ihre Mutter zur Toilette unterwegs ist, dreht sie sich ein wenig zu mir und legt das rechte Bein über das linke Knie, so dass ihr rosa Höschen unübersehbar ist, wenn ich nur halbwegs in die Richtung schaue. Das vermeide ich tunlichst, denn der Anblick ist weder erregend noch attraktiv, obwohl ihr dicken Oberschenkel durchaus gebräunt sind. Als sie gezahlt haben und aufstehen, kreuzt sich ihr und mein Blick – oh Gott, ich wollte das vermeiden! – und sie lächelt mich schelmisch und ein wenig triumphierend an.
29. Oktober
Heute den ersten Teil meiner Pflichtarbeiten erledigt: Lektorat für bluesnews. Es ist jetzt an der Zeit, meine Prioritäten zu verschieben in Richtung „Bobby first“. Das ist tatsächlich innere Arbeit, muss ich hier aber unbedingt lernen. Also lasse ich erst mal meine Datenbank-Arbeit für den Neuen Weg Arbeit sein und gehe auf ’nen Kaffee mit meinem Buch „die Zimtläden“.
 Auf dem Weg zum Plaza Central entdecke ich das Restaurante Jardin SabeRico [ungefähr: Gartenrestaurant reicher Geschmack]. Nachdem die Raumausstatter bis hierher noch nicht vorgedrungen zu sein scheinen (außer natürlich für die großen Hotelketten), sind sämtliche (na ja, fast sämtliche) Bistros, Café, Kneipen hier mit so viel Liebe und Improvisationslust eingerichtet und geschmückt, dass ich am liebsten überall reingehen und mich entzücken würde. Aus Europa kenne ich das nur in Ausnahmefällen. Hier beispielsweise haben sie Hüttchen aus Bambus gebaut, die grade so groß sind, dass ein Vierer- oder Sechsertisch reinpasst.
Auf dem Weg zum Plaza Central entdecke ich das Restaurante Jardin SabeRico [ungefähr: Gartenrestaurant reicher Geschmack]. Nachdem die Raumausstatter bis hierher noch nicht vorgedrungen zu sein scheinen (außer natürlich für die großen Hotelketten), sind sämtliche (na ja, fast sämtliche) Bistros, Café, Kneipen hier mit so viel Liebe und Improvisationslust eingerichtet und geschmückt, dass ich am liebsten überall reingehen und mich entzücken würde. Aus Europa kenne ich das nur in Ausnahmefällen. Hier beispielsweise haben sie Hüttchen aus Bambus gebaut, die grade so groß sind, dass ein Vierer- oder Sechsertisch reinpasst.
Der Kaffee ist wieder mal vorzüglich, ebenso das Stück Mandeltorte, ebenso das dicke Macadamia-Trüffel-Bällchen (Überraschung, hatte ich nicht bestellt, kostet 1 Quetzal = 15 Cent) ist handgemacht deftig köstlich. Davon sollte man mehr besorgen. Hier wie schon gestern und vorgestern genieße ich etwas, was es bei uns nur noch auf dem Land gibt: Menschen, die an meinem Tisch vorbeikommen, grüßen so gut wie immer mit einem Buenos Dias. Klar haben sie mich ein paar Sekunden später schon wieder vergessen, sympathisch ist es dennoch.
Beim Kaffee und Lesen erreicht mich die Idee zu einer Geschichte, die mich so unter Strom setzt, dass ich gleich wieder nach Hause gehe, um sie aufzuschreiben. Gutes Zeichen!
Und klappt auch ganz gut. Nach rund zweit Stunden „steht“ sie erst mal. Titel „Der Hampelmann“. Morgen werde ich sie überarbeiten (wenn ich dazukomme).
30. Oktober
Ich habe hier wirklich erstaunlich wenig Hunger. Heute Morgen eine Handvoll Früchte – Nisperos – zur Datenbankarbeit genascht. Die kleinen, gelben, birnenförmigen Früchte, die etwa so groß wie Mirabellen sind, gibt es von Oktober bis Dezember. Aber wie den Geschmack beschreiben? Ich glaube, ich lasse es lieber, mildfruchtig irgendwie und die Schale angenehm säuerlich. Die zwei bis vier dunkelbraun glänzenden Früchte sind so glatt, dass man sie im Mund mühelos ertastet und einfach ausspucken kann.
 Als Mittagessen habe ich zwei Handvoll Erdnüsse – von einem Straßenhändler – gegessen, außerdem eine halbe, frische Papaya. Das orange Fruchtfleisch ist avocadoweich, so dass man es einfach aus der Schale löffeln kann. Und wie schmeckt Papaya? Mir jedenfalls gut, mild süß wie eine Kombination aus Honigmelone und Aprikose. Wobei der Melonenanteil überwiegt. Geo hat ihr einen eigenen Artikel gewidmet: „Leckere Südfrucht mit heilender Wirkung. Die tropische Frucht ist eine wahre Vitamin-C-Bombe, hilft bei Magen-Darm-Problemen und stabilisiert das Immunsystem … Darüber hinaus zählt die Papaya zu den kalorienarmen Früchten und enthält kaum Fett. Außerdem weist die Tropenfrucht große Mengen des Superenzyms Papain auf, welches dabei hilft Eiweiß besser im Körper abzubauen.“ Also so ’ne Art Naturheilmittel zum Essen. Soll mir recht sein. Einen Fehler hab ich gemacht: Ich hab die Kerne in den Hausmüll gegeben, dabei sind die besonders gesund. Na ja, nächstes Mal.
Als Mittagessen habe ich zwei Handvoll Erdnüsse – von einem Straßenhändler – gegessen, außerdem eine halbe, frische Papaya. Das orange Fruchtfleisch ist avocadoweich, so dass man es einfach aus der Schale löffeln kann. Und wie schmeckt Papaya? Mir jedenfalls gut, mild süß wie eine Kombination aus Honigmelone und Aprikose. Wobei der Melonenanteil überwiegt. Geo hat ihr einen eigenen Artikel gewidmet: „Leckere Südfrucht mit heilender Wirkung. Die tropische Frucht ist eine wahre Vitamin-C-Bombe, hilft bei Magen-Darm-Problemen und stabilisiert das Immunsystem … Darüber hinaus zählt die Papaya zu den kalorienarmen Früchten und enthält kaum Fett. Außerdem weist die Tropenfrucht große Mengen des Superenzyms Papain auf, welches dabei hilft Eiweiß besser im Körper abzubauen.“ Also so ’ne Art Naturheilmittel zum Essen. Soll mir recht sein. Einen Fehler hab ich gemacht: Ich hab die Kerne in den Hausmüll gegeben, dabei sind die besonders gesund. Na ja, nächstes Mal.
Heute Vormittag war ich quasi ganz touristisch unterwegs und hab die beeindruckende Ruine des Frauenklosters Santa Clara besichtigt – mit individueller Führung. Mein Guide sprach halbwegs verständliches Englisch, nur einmal hatten wir ein großes Verständigungsproblem. Er sprach immer von Warren und deutete dabei auf einen hübsch angelegten Platz rundum einen Brunnen. Warren, Warren? Ich hab im Leo nachgeschaut, aber außer Kaninchenbau gibt es keine weitere Bedeutung. Hm … ein junger Guatemalteke half uns aus der Patsche. Gemeint war „Wedding“. Der Platz wird also heute an Hochzeitler vermietet. An einer Stelle seiner Führung hat er sich bald weggeschmissen vor Lachen. Er erzählte mir, dass die Nonnen oft krank waren, vielleicht weil sie barfuß laufen mussten (obwohl es damals kälter war als heute) und nicht sprechen durften, seien sie durchschnittlich nicht älter geworden als 50. Ich hab dann ergänzt: Kein Wunder, nicht sprechen dürfen und kein Sex, da muss man ja früh sterben!