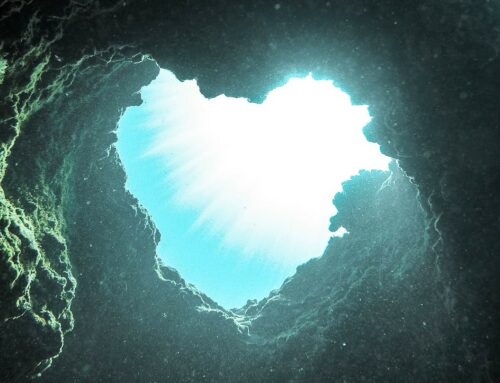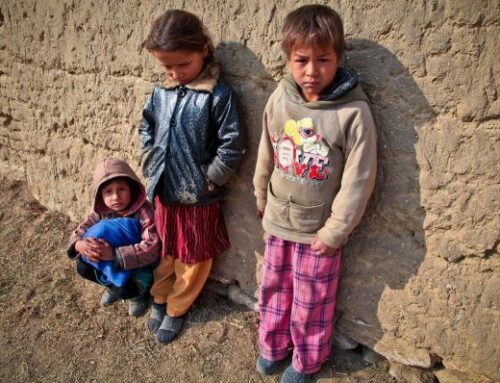Als ich vor vielen Jahren Krishnamurtis Satz las „Die Wahrheit ist ein pfadloses Land“, ahnte ich nicht, dass auch ich damit gemeint sein könnte. Nicht, weil ich mich für die Wahrheit hielte, sondern weil ich irgendwann an den Punkt kam zu fragen, „Wer ist das: Ich?“ Als Antwort lag es nahe, nach „jemand“ zu suchen, nach einer Person, nach einer Identität, nach etwas Definierbarem. Aber da ist nichts Definierbares, was auch nur halbwegs „Ich“ wäre. Diese Vorstellung ist ein Bluff, eine optische Täuschung, die mich ein Leben lang auf Trab halten könnte, ein Bluff, der sich aus meinem Bedürfnis nach Sicherheit speist. Aber selbst dieses Bedürfnis ist synthetisch; denn alles an mir ist Ausdruck einer Sicherheit, die ich im Augenblick meiner Zeugung und meiner Geburt erhalten habe: meinen Körper, meinen Geist – und sei er noch so flüchtig –, vielleicht auch meine Seele, falls es sie gibt und sie nicht auch ein beliebig austauschbares Konzept ist. Ist es nicht schon Ausdruck von Überheblichkeit zu meinen, ich mit meinen Billionen Zellen und einem Gehirn, das mich befähigt, dies zu denken und zu schreiben, sei mir noch immer nicht genug? Nicht die verwirrende Vielfalt der möglichen Antworten auf die Frage nach dem Ich ist das Problem, das Problem ist bereits die Suche selbst. Wie also kann sie zu einem anderen als verwirrenden Ergebnis führen!
Natürlich bin ich das Ergebnis meiner Gene, meiner Eltern, Familie, Freunde, Schule, Beruf, meiner Geliebten, der von mir gelesenen Bücher und geschauten Filme, der Nahrung, die ich zu mir nehme. Ich bin ein Sammelsurium, aus dessen brodelnder, mal dünn-, mal zähflüssiger, mal transparenter, mal trüber Masse etwas herausschaut und sich einbildet, mit dieser Frage „Wer bin ich?“ irgendwelche Ordnung und Orientierung in der Angelegenheit zu bekommen. Schon die Frage selbst verändert das ganze Ding. Ich kann nichts tun, ohne nicht schon wieder ein anderer zu sein. Wie kann ich vermuten, dass alles mit allem zusammenhinge und mich davon auszunehmen? Alles in mir fluktuiert, ändert sich beim Anblick eines leckeren Kuchenstücks, strukturiert sich in Windeseile um beim Anblick einer begehrenswerten Frau und wird zusammengehalten von einem kulturell vorgefertigten „Ich-Gefühl“. Dankeschön, liebes Gefühl, gäbe es dich nicht, würde ich beim Ansturm einer wilden Horde namens Alltag, namens Hormone, namens Konflikte, namens, namens … auseinanderfallen wie eine Mauer ohne Mörtel. Ja, ich bin ein pfadloses Land, das auf sich selbst zurückblickt. Und in der amüsant ausweglosen Freiheit dieses endlosen Selbstbezugs kann ich mir eine beliebige Richtung geben, ohne glauben zu müssen, dies und nur dies sei die Wahrheit.